An der Grenze balancieren
Interview, derstandard.at, 6. Juli 2010
Der Autor Semier Insayif über Vielschichtigkeit, Vielstimmigkeit und seine Skepsis gegenüber „nationalen Zuschreibungen“.
Standard: In deinen Texten arbeitest du sowohl inhaltlich als auch formal sehr stark mit Grenzen. Oft hat man das Gefühl, dass du diese entlang schreitest und auf ihnen herumtänzelst, ohne dabei ganz in die eine oder andere Richtung zu kippen. Woher kommt das?
Insayif: Das An-Der-Grenze-Balancieren ermöglicht, mal hier rüberzusehen und mal dort rüberzusehen. Aber man könnte diesem Gestus natürlich auch vorwerfen, dass man niemals wirklich hier und niemals wirklich dort ist. Ich überlege gerade, ob dieses Bild, so schön es auch ist und so sehr es mir auch nahe steht, nicht auch etwas vermissen lässt. Jetzt drängt sich mir die Frage auf, ob meine Art zu Schreiben etwas vermissen lässt, oder ob das Bild noch nicht ganz vollständig ist – wovon ich idealerweise ausgehen muss.
Ich würde schon behaupten, dass ich auch eintauche. Brechen und Eintauchen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn mir beides gelänge; sowohl in der Poesie, als auch im wirklichen Leben finde ich das sehr spannend.
Auf diese Vielschichtigkeit und Vielstimmigkeit legst du auch in deinen Texten viel Wert. Siehst du dich selbst als Vermittler, diese Stimmen hörbar zu machen?
Ich habe oft das Gefühl, dass wir mehr Dividuum sind und nicht Individuum – davon halte ich sehr viel, von diesem „Chor an Stimmen“, den wir in uns haben, diesen Chor an unterschiedlichen Kulturen. Wir tragen alle unterschiedlichen Gesellschaften in uns und unterschiedliche Stimmen, wobei es völlig egal ist, von woher man kommt. Ich versuche möglichst alle Stimmen zu hören – manchmal als Chor und manchmal als Einzelstimme. Diese Heterogenität wünsche ich mir nicht nur für mein Schreiben, sondern genauso für den Markt.
Inwiefern wird diese Heterogenität vom Markt eingeschränkt?
Wenn „der Markt“ bedeutet: Das ist jetzt en vogue, dann gibt es einen Kanon. Und auch heute existieren LiteraturkritikerInnen und ein mediales Umfeld, die noch immer sagen: So und so kannst du nicht schreiben. Mit der rumänischen Lyrikerin Nora Luga habe ich einmal gemeinsam an einem Poesiefestival teilgenommen. Dort hat sie die Frage aufgeworfen: „Wie wäre es eigentlich, wenn es keine LiteraturkritikerInnen gäbe? Würden wir dann nicht viel bessere Literatur schreiben?“ Ich finde das schön, auch einmal so ein Gedankenexperiment machen zu können, ohne dabei ständig Seitenhiebe auf die Literaturkritik machen zu wollen, weil sie ja auch viel Positives bewirkt.
Lyrik ist auf dem Markt nur recht spärlich vertreten. Empfindest du als Lyriker das als Einschränkung?
Wenn du Lyrik schreibst, rechnet keine Sau damit, dass du etwas verkaufst. Jeder sagt, dass es ein Glück ist, wenn du Gedichtbände veröffentlichen darfst. Aus verkaufstechnischen Gründen machen das immer weniger Verlage. Was sollen sie auch damit, das lässt sich ja nicht verkaufen. Da es also überhaupt keine Erwartungshaltung in Bezug auf den Verkauf gibt, bist du insofern als Lyriker freier. Heutzutage liest fast ohnehin nur Fachpublikum Gedichte. Nahezu ausschließlich Lyrikerinnen und Lyriker lesen Lyrik.
Du hast zuletzt „Faruq“ veröffentlicht. Wie gehst du damit um, wenn der Roman unter dem Begriff „Migrationsliteratur“ verhandelt wird?
Ich schreibe natürlich keine Migrationsliteratur, allerdings ist es eine Möglichkeit von vielen, mich so zu rezipieren. Das ist ja auch nichts Böses und in mancher Hinsicht auch verständlich. Aber Migrationsliteratur wäre aus meiner Sicht natürlich das Herausziehen eines einzigen Faktors und würde das Gesamte zum Einstürzen bringen. Der Faktor der Bikulturalität hat in meinem Buch ‚Faruq‘ tatsächlich eine große Bedeutung, aber es ist eben nur ein Aspekt. Die Reduktion darauf hätte zur Folge, dass die Gewichtung für mich nicht mehr passt, deshalb versuche ich auch Lesungen zu machen, die andere Gewichtungen setzen sollen.
Du vermeidest es, Zugehörigkeiten festzuschreiben, obwohl du in Österreich geboren und aufgewachsen bist. Woher kommt das?
Also wenn mich jemand fragt, ob ich Österreicher bin, kann ich nie „ja“ sagen, obwohl ich wahnsinnig gerne hier lebe. Ich habe grundsätzlich eine große Skepsis Nationalstaaten als Konstrukt gegenüber. Ich verstehe das nicht, was soll das heißen? – „Ich bin Österreicher“. Das ist diese Staatsgrenzenstruktur, die so was von wenig Aussage für mich hat. „Die Russen“ und „die Österreicher“, ich weigere mich, mit solchen Schlagwörtern, solchen Stigmata, mit solchen Nullaussagen zu arbeiten.
Friedrich Teutsch, Kathi Haderer, Andrea Kern, Jakob Cencig*, 6. Juli 2010, derstandard.at
Das Interview entstand im Rahmen der MALCA-Konferenz „Überkreuzungen: Verhandlungen kultureller, ethnischer, religiöser und geschlechtlicher Identitäten in österreichischer Literatur und Kultur“.
Das Gespräch führten Studierende* vom Institut für Germanistik an der Universität Wien.

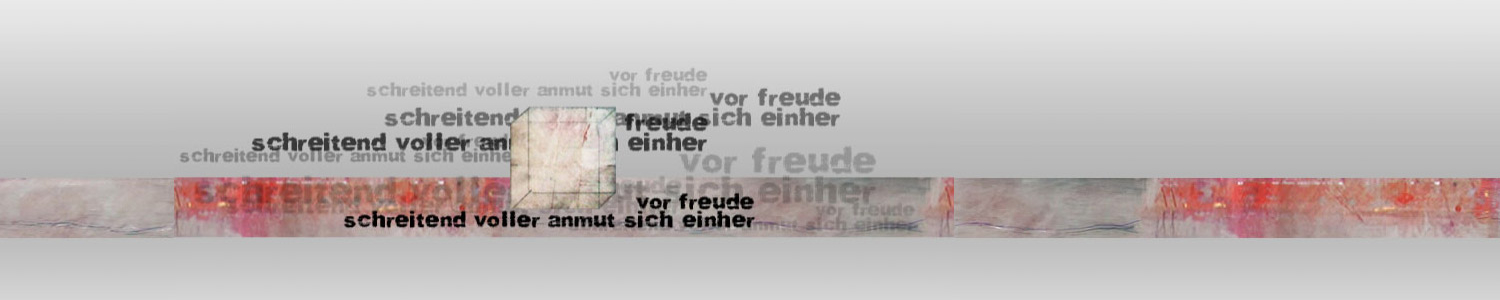
 Aktuelle Publikation:
Aktuelle Publikation: